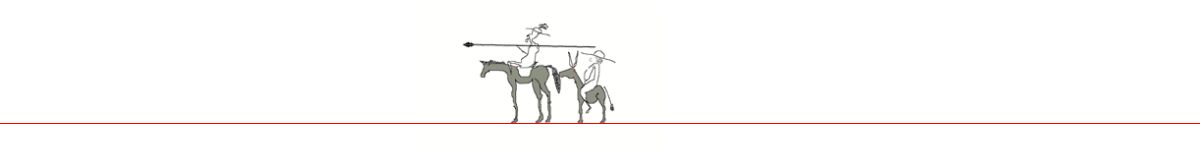„was schaut ihr denn da, kinder?“
„eigentlich etwas relativ dummes.“
der fortschritt ist die akzeptanz; ich gehe aus und bin nicht da, um vorzulesen, noch was zu wissen, lichtaus durchzusetzen, alle wissen, dass sie heimlich tv gucken werden, weil mir die energie fehlt, um die fernbedienung ins auto, den schlüssel in den briefkasten zu packen, oder in den tiefkühler, oder unter die blumenkästen. man muss es klar sagen: der kulturhunger der mutter ermöglicht den kindern kulturlosigkeit, auf perfekte weise, weil sie es im geheimen tun können. ich habe ihnen gesagt, wenn sie erben wollten, müssen sie vorher alle meine bücher lesen. „okay“ sagt gregor.
„strassenecke„: die ersten seiten erinnern mich an die, die ich war, als ich jahnn gelesen habe, ich finde das sofort wieder in mir, es ist alles da („Alle Menschen denken einmal im Morgengrau zwischen Schlaf und und Wachen oder zufällig in einer dünnen Stunde bei einem Glas Absinth oder als sie sich entkleiden, das Hemd von der Haut abheben oder als die Strassenbahn in den Schienen knirscht, sie denken an sich wie der Geist an sie gedacht, als er sie bildete. Durch sie hindurch und in sich hinein. Und die Gedanken sind dolchartige Eisen […]“ und so weiter, dann übermannt ihn der expressionismus, bin hin zum „fettes spratzendes Höllenfeuer“ und solche dinge, dieses hemmungslose sich-ernst-nehmen, das man heute in literarischen texten nur noch mit dem autoren-ich und seinen wahrnehmungen tut und nicht mehr mit der gesamten welt.)
das stück sei nicht erzählt worden, lese ich in der kritik einer aufführung von 1994, das jugendtheater (wusste ich nicht vorher, ich hab „P14“ nicht wahrgenommen in der ankündigung, sie hätten aber auch einfach „jugendtheater“ hinschreiben können, die hanseln) hier tut das auch überhaupt nicht, leider, einigen schauspielern hätte ich ein bisschen mehr schauspiel schon zugetraut. der abend war interessant zumindest, volksbühne dritter stock, ein vollkommen leerer raum (bühnenbild bert neumann, der hatte wohl keine zeit) mit je drei stuhlreihen an den schmalen enden, die kids sind großartig textsicher, laufen herum und haben die beiden verwendeten darstellerischen möglichkeiten spielend im griff: monotones bisschen zu schnelles vortragen ohne körperbeteiligung und hemmungsloses brüllen, beides fordert zuschauer mit extrem guten ohren und zenmässiger konzentrationsfähigkeit, weil der text so unzeitgemäß dicht und gewaltig ist, auch die handungsverläufe sind sehr vielfädrig. am ende öffnen sie die 4 fenster des raumes, zum theatervorplatz hin, und machen das licht aus, es leuchten nur noch die lampen von draussen, auch die gehen irgendwann aus, niemand spricht noch, man sitzt im dunkeln, friert und hat keine ahnung, ob sie durch sind mit dem text. das publikum sass am ende sehr gutwillig minutenlang herum, bevor jemand mit dem beifall begonnen hat. ich mochte das, nur das restlicht von der stadt im raum, theater und stadt beide dabei, plus das magische eines unbespielten theaterraumes. wie ein schlafzimmer, das stück schläft wieder, denkt man so ein bisschen verträumt und guckt aus dem fenster in den berliner nachthimmel.
ich konnte mich trotz guter absichten (hh jahnn!) nicht immer auf den text konzentrieren und habe nicht verstanden, warum die regisseurin das so inszeniert hat. oder haben die kids das alleine entschieden? ein paar sätze dazu auf dem programmzettel wären hilfreich gewesen. ich wollte nicht rausgehen bei so jungen leuten, einer war noch vorm stimmbruch, aber versucht war ich schon. die ganze jahnnsche sprachgewalt und meinungsdichte wurde wegmonologisiert – oder eben niedergebrüllt.
„Boh„, sagt der italiener dazu. schnell nach hause radeln, hund lüften, die kinder ins bett schicken, „mama, wie spät ist es denn jetzt genau?“ „23:06“ „okay, dann schlaf ich jetzt.“